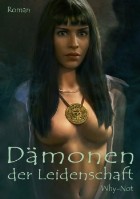Dämonen der Leidenschaft
von Why-Not
Tredition Verlag
SM-erotische Erzählung (Mystery Thriller)
240 Seiten
ISBN 978-3-7482-7714-9 (Buch)
ISBN 978-3-7482-7715-6 (eBook)
ISBN 978-3-7482-7715-6 (eBook)
Inhalt des Romans
In ihrem Mexiko-Urlaub besucht die 25-jährige Anita nach einer Nacht voller Alpträume eine uralte indianische Kulttätte. Obwohl die Touristenattraktion völlig überlaufen ist, gelingt es einer kriminellen Bande, Anita fortzulocken und zu entführen. Sie wird gefangen gehalten, gedemütigt und von einem skrupellosen Sadisten ersteigert, der ihr damit droht, sie als Organspenderin auszuschlachten, wenn sie sich ihm nicht fügt. Ein Fluchtversuch misslingt. Zwar taucht ein Mann auf, der Anita im letzten Moment vor einem grausamen Schicksal bewahrt, doch ihr Retter, ein seltsam undurchsichtiger Mann, scheint dabei auch nur eigennützige Ziele zu verfolgen. Er verunsichert Anita, schüchtert sie ein. Trotzdem ist sie von ihm fasziniert. Er entfacht in ihr den wilden Drang, sich ihm zu unterwerfen. Wie unter einem Zwang gibt sie diesem Verlangen nach und wird in ein Leben geführt, das sie sich nie hätte vorstellen können.
Leseprobe
Im Hotel
Was für ein Leben! Lächelnd schaute sie sich um. Nicht nur, dass sie ihren Traummann gefunden hatte, es musste auch noch der wichtigste Mann in der ganzen Stadt sein. Na gut, einer der beiden wichtigsten. Wobei sie sich nicht hätte vorstellen können, mit seinem Bruder zusammenzuleben. Irgendwie verursachte dieser ihr eine Gänsehaut, wenn sie ihm begegnete. Es schien ihn immer ein eiskalter Hauch zu umwehen. Ganz anders als bei ihrem Mann. Zwar hatte auch er die Aura eines Machtmenschen, aber er war ehrlich und berechenbar.
Wo blieb er bloß? Eigentlich sollte er schon längst hier sein. Sie hörte ein Poltern aus dem Nebenraum. Schnell lief sie hin. Ihr Mann taumelte herein und hielt sich die Brust. Bevor sie etwas sagen konnte, schüttelte er energisch den Kopf.
»Die Sonnenscheibe«, keuchte er, »er darf sie auf keinen Fall behalten.«
Seine Tunika färbte sich um seine Hand herum tiefrot, während sein Gesicht kaum noch Farbe hatte. Sie wollte ihm helfen, aber er wehrte sie mit der linken Hand ab.
»Was mit mir passiert, ist nicht wichtig«, fuhr er immer leiser fort, »aber du musst ihm die Sonnenscheibe abnehmen. Bring sie zum Wald am Stadtrand, dort, wo er am dunkelsten wird. Alles andere ist unwichtig. Versprich es!«
»Dein Bruder?«, fragte sie, obwohl sie die Antwort bereits kannte.
»Wer sonst! Versprich mir, dass du die Sonnenscheibe zum dunklen Waldstück bringst!«
»Ja, mein Geliebter, ich verspreche es.«
Ihre Stimme war fast so brüchig wie seine. Tränen standen in ihren Augen.
»Dann werden wir uns wiedersehen«, waren seine letzten Worte, bevor er zusammenbrach.
Sie stieß einen erstickten Schrei aus und nahm ihn in die Arme. Aber er war bereits tot. Sie schob seine erschlaffte Hand zur Seite und erblickte ein faustgroßes Loch in seiner Brust, direkt unterhalb des Brustkorbs. Einen Moment lang war sie wie erstarrt. Behutsam ließ sie den toten Körper ihres Mannes zu Boden gleiten.
Ihr Gesicht glich einer ausdruckslosen Maske, als sie sich erhob. Dann sah sie sich suchend um. Zielstrebig ging sie auf eine Kiste zu und entnahm ihr ein Obsidianmesser.
Schweißgebadet fuhr Anita hoch. Ihr Herz raste. Was war das für ein scheußlicher Traum gewesen? So einen realistischen Albtraum hatte sie noch nie gehabt. War ihr der Hamburger nicht bekommen, den sie nach ihrer Ankunft am Flughafen gegessen hatte?
Sie setzte sich auf die Bettkante und atmete ruhig durch. Ihre Hände zitterten leicht. Nur langsam beruhigte sie sich wieder. Fahrig tastete sie nach dem Schalter der Nachttischlampe. Als das schummrige Licht anging, ließ sie ihren Blick durch das Hotelzimmer schweifen. An der gegenüberliegenden Wand hing noch immer das kitschige Bild mit den bunt gekleideten Personen. Auch der Rest der eher schlichten Einrichtung war an seinem Platz. Alles war völlig in Ordnung. Allmählich hörten ihre Hände auf zu zittern. Sie hatte einfach nur einen blöden Traum gehabt.
Mit einem Ruck stand sie auf und ging zu dem kleinen Tisch, auf dem die Touristik-Prospekte lagen. Ob die Bilder der Landschaft und der Kunstgegenstände sie zu ihrem Traum inspiriert hatten? Einige Obsidianobjekte waren darunter, nicht aber das Messer aus ihrem Traum. Wenn sie morgen ihren ersten Ausflug machte, würde sie hoffentlich positivere Impressionen sammeln.
Langsam kehrte die Müdigkeit zurück. Ein wenig sträubte sie sich noch gegen das Einschlafen. Sie hatte Angst, der verrückte Traum könnte weitergehen. Schließlich legte sie sich doch wieder in das Hotelbett. Denn morgen wollte sie ausgeschlafen sein.
Möglichst unauffällig schlich sie bei beginnender Dämmerung am Rande des großen Platzes entlang. Sie war nur noch wenige Schritte vom Hintereingang des Hauses entfernt. Niemand schien Notiz von ihr zu nehmen. Einen Moment später schlüpfte sie durch die Tür. Sie hörte bereits sein kaltes Lachen und spürte, wie sich ihre Eingeweide zusammenzogen. Wut und Angst hielten sich bei ihr die Waage. Vorsichtig schlich sie zur nächsten Tür und spähte kurz hinein. Er stand mit dem Rücken zu ihr und ließ sich in seine bunte Robe helfen. Sie sah das Lederband in seinem Nacken und wusste, dass daran die Sonnenscheibe hing, die er ihrem Geliebten abgenommen hatte. Am liebsten wäre sie schreiend mit dem Messer auf ihn zugelaufen, um ihn zu erstechen. Aber dann wäre der Überraschungseffekt verschenkt gewesen, und ohne diesen hätte sie gegen ihn keine Chance. Dann kam ihre Gelegenheit. Ein Diener ließ eine Schale mit Kräutern fallen und der Mörder ihres Mannes schrie ihn wütend an. Mehr Ablenkung durfte sie nicht erhoffen. So leise wie möglich näherte sie sich ihm, nahm das Messer in beide Hände und rammte es dort, wo das Lederband verlief, in sein Genick. Es gab ein hässliches Geräusch, als das Messer sich seinen Weg zwischen zwei Halswirbel bahnte. Zu ihrem Entsetzen brach er nicht sofort zusammen, sondern drehte sich noch mit dem Messer im Genick zu ihr um. Sein Gesicht war hasserfüllt, während er sie anstarrte. Sie fürchtete, dass er jeden Moment das Messer herausziehen und sie töten würde, wie er es mit ihrem Mann getan hatte. Der Gedanke an ihren Geliebten holte sie aus ihrer Erstarrung. Sie griff nach der Sonnenscheibe und zerrte mit aller Kraft daran. Das Lederband, das sie mit ihrem Messer angeschnitten haben musste, riss und gab die goldene Scheibe frei. So schnell sie konnte, flüchtete sie aus dem Haus. Hinter ihr erschollen erste Alarmrufe.
Rennend überquerte sie die große Straße und verschwand in einer der kleinen Gassen. Zunächst wechselte sie ziellos die Richtung. Schließlich erinnerte sie sich, wohin sie die Sonnenscheibe bringen sollte. Für einen Moment lehnte sie sich an eine Hauswand und rang um Atem. Ihre Hand umklammerte die Sonnenscheibe, an der noch immer das Lederbändchen hing. Dessen Enden verknotete sie und hängte sich das Schmuckstück um den Hals. Sorgfältig steckte sie die Scheibe unter ihre Tunika, um sie vor neugierigen Blicken zu verbergen. Dann ging sie langsamer und zielstrebig zum Viertel der Obsidianschleifer, das am Fuße der zweiten, großen Pyramide lag. Von dort aus war der Wald bereits zu erkennen. Sie fragte sich, was sie mit der Sonnenscheibe machen sollte, wenn sie in dem dunklen Waldstück angekommen war. Zumindest würde sie versuchen, sie dort zu verstecken. Warum ihr Geliebter glaubte, dass sie dort sicher sei, war ihr allerdings nicht klar. Trotzdem würde sie genau das tun, was er von ihr verlangt hatte.
Sie war überrascht, dass sie überhaupt so weit gekommen war. Normalerweise konnte man sich weder ihrem Mann noch seinem Bruder unbemerkt nähern, geschweige denn, sie überrumpeln. Auch wusste sie nicht, warum sie das Messer genau auf diese Weise eingesetzt hatte. Es schauderte ihr bei dem Geräusch, das sie in Gedanken noch immer hörte. Aber offenbar hatte sie es genau richtig gemacht. ...
Erneut schrak Anita aus ihrem Bett hoch. Das durfte doch nicht wahr sein. Jetzt hatte sie doch tatsächlich den Albtraum von vorhin weitergeträumt! Wieder unglaublich realistisch. Sie erinnerte sich an das grässliche Geräusch, das das Messer verursacht hatte und an das Gewicht der Sonnenscheibe. Bei der Erinnerung lief es ihr kalt den Rücken herunter.
Plötzlich hatte sie ein Verdacht. Sie sprang förmlich aus dem Bett und begann, in ihrem Koffer zu wühlen. Triumphierend hielt sie ein Amulett hoch, das sie erst kürzlich zu Hause auf einem Flohmarkt erstanden hatte. Aus einer Laune heraus hatte sie es mit in den Urlaub genommen. Sie nahm es in die Hand. Es schien zwar aus Ton zu sein und war etwas größer, hatte aber ungefähr das Gewicht der Sonnenscheibe aus ihrem Traum.
»Du bist also die Inspiration für meinen Albtraum«, murmelte sie, während sie das Amulett anstarrte. »Und für so einen Mist zahle ich auch noch zwanzig Euro! Weißt du, was du mich mal kannst?«
Sie schleuderte es mit Schwung in den Papierkorb. Dann ging sie zurück in ihr Bett. Mit dem festen Vorsatz, jetzt einen angenehmen Traum – am besten von einem Traummann – zu haben, schloss sie die Augen und schlief ein.
Aus verschiedenen Richtungen kamen laute Rufe. Offenbar suchte man nach ihr. Sie musste sich beeilen, wenn sie ihre Aufgabe noch erfüllen wollte. Dass ihr danach die Flucht gelingen würde, bezweifelte sie. Aber wo sollte sie auch hin? Sie riss sich zusammen. Zunächst musste sie zum dunklen Waldstück. Über alles andere würde sie sich später Gedanken machen.
Als die Rufe näher kamen, verfiel sie in einen Dauerlauf. Sie durfte sich auf keinen Fall erwischen lassen. Nicht, bevor sie ihre Aufgabe erfüllt hatte.
Die letzten Häuser fielen hinter ihr zurück. Sie war jetzt auf freiem Feld und hatte noch eine längere Strecke bis zum Waldrand zurückzulegen. Den Rufen hinter sich entnahm sie, dass man sie entdeckt hatte. Trotz des schmerzhaften Stechens in ihren Lungen erhöhte sie das Tempo und schlug Haken, um nicht von einem Pfeil getroffen zu werden.
Sie hatte den Waldrand gerade erreicht, als sich doch noch ein Pfeil in ihre Hüfte bohrte. Für einen Schmerzensschrei fehlte ihr die Luft. Stolpernd rettete sie sich vor weiteren Pfeilen hinter die ersten Bäume. Ein pochender und brennender Schmerz drängte sich in ihre Wahrnehmung. Auch, wenn sie sich nicht die Zeit nahm, die Wunde anzuschauen, wusste sie doch, dass sie diese Verletzung nicht überleben würde. Mit der Kraft der Verzweiflung stolperte sie auf das dunkle Waldstück zu. Sie wurde dabei immer langsamer und ihre Verfolger kamen näher. Ob sie noch die Zeit haben würde, die Sonnenscheibe wirkungsvoll zu verstecken? Schließlich erreichte sie ihr Ziel und musste trotz ihrer Schmerzen lächeln.
Auf einem Baumstumpf saß ein grüner Vogel mit scharlachroter Brust. Ein heiliger Vogel, der ihrem Geliebten manche Schwanzfeder geschenkt hatte. Jetzt wusste sie, was sie zu tun hatte. Sie nahm die Sonnenscheibe aus ihrer Tunika und hielt sie dem Vogel entgegen. Der erhob sich von seinem Baumstumpf und ergriff die Scheibe mit seinen Krallen. Dann schraubte er sich langsam mit seiner Last immer weiter in die Höhe und stieß seinen typischen Ruf aus. Ungläubig sah sie, dass einige Pfeile auf den Vogel abgeschossen wurden. Hinter sich nahm sie Kampfgeräusche wahr. Als sie sicher war, dass der Vogel die Reichweite der Pfeile verlassen hatte, drehte sie sich um. Die Anhänger des Mörders ihres Mannes wurden von anderen Tempelwächtern attackiert, die den Frevel, auf den heiligen Vogel zu schießen, nicht ungesühnt lassen wollten. So, wie es aussah, würde es keine Sieger geben. Letztlich war es ihr egal. Sie hatte ihre Aufgabe erfüllt. Noch einmal hörte sie den Ruf des Vogels. Lächelnd brach sie zusammen. ...
Als Anita am nächsten Morgen aufwachte, fühlte sie sich wie gerädert. Ihr nächtlicher Wutanfall hatte offenbar nicht verhindert, dass sie diesen verrückten Traum bis zum Ende miterleben musste. Außerdem irritierte es sie, dass der Traum bei allen seltsamen Details realistisch und schlüssig war. Ganz anders als ein normaler Traum oder Albtraum. Zudem bauten alle drei Teile nahtlos aufeinander auf.
Nach dem dritten Teil des Traums, an den sie sich genauso detailliert erinnern konnte wie an die anderen, war der Spuk zu Ende gewesen. An weitere Träume in dieser Nacht konnte sie sich nicht erinnern. Hoffentlich war dieses seltsame Thema jetzt abgeschlossen. Und hoffentlich sah man ihr diese anstrengende Nacht nicht an. Sie ging ins Badezimmer und schaute in den Spiegel. Nein, sie sah aus wie immer. Sie hatte sogar das Gefühl, ihre leicht exotischen Gesichtszüge, die von den langen schwarzen Haaren unterstrichen wurden, würden heute noch besser zur Geltung kommen.
Wenn es schon nichts geholfen hatte, das Amulett wegzuwerfen, konnte sie es auch genauso gut wieder an sich nehmen. Sie fischte es aus dem Papierkorb und spülte es im Bad unter fließendem Wasser ab. An einer Seite hatte der Ton einen Sprung bekommen. Als sie dagegen klopfte, brach ein Stück ab. Allerdings schien es sich nur um eine äußere Schicht zu handeln. Neugierig entfernte Anita noch mehr von der tönernen Hülle. Darunter kam ein dunkles Metall zum Vorschein, an dem Anita sich die Hände schmutzig machte. Mit Duschgel und einer Bürste versuchte sie, sich und das Metall zu säubern. Verdutzt hielt sie inne. Unter dem Dreck kam ein gelblicher, warmer Glanz zum Vorschein. Das Medaillon schien aus Gold – zumindest aber aus Messing – zu bestehen. Je weiter sie die Scheibe säuberte, desto mehr glich sie der Sonnenscheibe aus ihrem Traum. Mit einem Durchmesser von etwa sieben Zentimetern war sie nicht besonders groß. Doch obwohl sie höchstens einen halben Zentimeter dick war, hatte sie ein erstaunliches Gewicht. Durch die deutlich dickere Tonumhüllung war ihr das bisher nicht aufgefallen. War die Scheibe tatsächlich aus Gold? Dann musste sie ein kleines Vermögen wert sein. Anita kniff sich in den Arm. Da es ihr wehtat, ohne dass sie aufwachte, war das jetzt wohl kein Traum mehr. So langsam wurde ihr die Angelegenheit unheimlich. Auf was war sie da gestoßen? Sie betrachtete die Scheibe genauer. In ihrem Traum war die Scheibe an einem Lederband um den Hals getragen worden, und nachdem sie die letzten Reste der Tonschicht entfernt hatte, erkannte sie genau die beiden Löcher zum Durchfädeln des Bands.
Teotihuacán
Unschlüssig drehte sie das Amulett mit den Fingern. Was sollte sie damit tun? Sie wollte schließlich nicht jede Nacht von diesen Albträumen heimgesucht werden. Dass ihre Träume von diesem Amulett ausgingen, stand für sie außer Zweifel. Einen Moment lang dachte sie daran, es doch wieder wegzuwerfen. Allerdings fühlte sie sich gleichzeitig auf eine seltsame Weise zu der Sonnenscheibe hingezogen. Ihr war, als gäbe es eine tiefere Verbindung zwischen ihr und dem Gegenstand, auch wenn sie diese nicht näher benennen konnte. Vernünftig wäre es, das Amulett in das kleine Schließfach ihres Zimmers zu legen, wenn sie heute ihren Ausflug machte. Die Vorstellung, ihr Zimmer ohne diese Scheibe zu verlassen, machte sie jedoch unruhig.
»Na gut, dann kommst du eben mit. Und ich weiß auch schon, wie ich dich trage.«
Zufällig hatte sie einen Schmuckstein, der an einer Lederkette getragen wurde, mitgenommen. Sie brauchte nur die Anhänger auszutauschen. Allerdings passten weder die silberne Öse an dem einem Ende der Lederkette, noch der Federringverschluss am anderen durch die Löcher der Sonnenscheibe. Kurz entschlossen schnitt sie beide Enden mit einer Nagelschere ab, zog das Lederband durch die Öffnungen und verknotete es in ihrem Genick. Sicherheitshalber trug sie das Amulett unter ihrer Bluse. Sie wollte schließlich nicht riskieren, wegen dieses auffälligen Schmucks überfallen zu werden. Dann schnappte sie sich etwas Geld, legte ihre Papiere in das Schließfach und verließ das Zimmer.
Im Foyer des Hotels sammelte sich bereits die kleine Touristenschar, die den Ausflug zu den Ruinen von Teotihuacán mitmachen wollte. Anita gesellte sich zu ihnen.
»Entschuldigen Sie, aber sind Sie nicht die Schauspielerin aus den beiden Mumien-Filmen?«, fragte einer der Touristen.
»Fünfhundertsiebenundneunzig«, antwortete Anita resigniert.
»Wie bitte?«
»Sie sind der Fünfhundertsiebenundneunzigste, der mich danach fragt. Nein, ich bin nicht die Darstellerin der Anck-Su-Namun aus den Mumienfilmen. Wir sind auch nicht verwandt, obwohl wir zufällig den gleichen Nachnamen haben.«
»Tut mir leid, wenn ich Sie damit belästigt habe. Aber Sie sehen ihr wirklich zum Verwechseln ähnlich.«
»Schon okay. Wahrscheinlich sollte ich mich freuen, so hübsch wie diese Filmschauspielerin zu sein. Besser, als Mutter Beimer ähnlich zu sehen.«
»Wem?«
»Ach egal, vergessen Sie’s.«
Im klimatisierten Bus verließen sie Mexiko-City. Die kleine Reisegesellschaft bestand überwiegend aus älteren Paaren und aus ein paar esoterisch angehauchten Spinnern, die etwas von den »Schwingungen der Vergangenheit« faselten.
Anita zog es vor, aus dem Fenster zu schauen und vor sich hin zu dösen, statt sich mit den anderen Fahrgästen zu unterhalten. Sie verlor dabei völlig das Gefühl für die Zeit. Nach einer Weile drehten sich ihre Gedanken wieder um den Traum, den sie letzte Nacht gehabt hatte. Die Erinnerungen daran waren immer noch erschreckend klar und detailliert. Sie fragte sich, was es mit diesem Traum wohl auf sich haben mochte. Ob das Amulett sich an seine Vergangenheit erinnerte und sie teilhaben ließ? Sie lächelte. Solche Gedanken wären eher etwas für die esoterischen Mitfahrer, die nun über die »Magie des untergegangenen Volkes« spekulierten, das einst in den Ruinen von Teotihuacán gelebt hatte.
Inzwischen hatte der Bus einen großen Parkplatz erreicht, auf dem zahllose weitere Reisebusse standen. Das würde wohl ein ziemlicher Rummel werden, wenn all die Touristen aus den anderen Bussen bereits in den Ruinen herumliefen. Wieso war sie überhaupt hierher gekommen? Klar, untergegangene Kulturen hatten schon einen gewissen Reiz, insbesondere, wenn sie so mysteriös waren, wie die hiesige. Tatsächlich wusste man so gut wie nichts über die Bewohner, die die beiden großen Pyramiden und die Tempelanlagen erbaut hatten. Selbst die Azteken hatten diesen Ort erst entdeckt, als er bereits verlassen war. Von ihnen hatte er auch seinen Namen bekommen: Teotihuacán – »der Ort, an dem Menschen Götter wurden«. Zumindest stand es so in ihrem Reiseführer. Der ursprüngliche Name der Stadt war ebenso verschwunden, wie seine Bewohner.
Bevor Anita und die anderen Touristen aus ihrem Bus einen Blick auf die Ruinen werfen konnten, mussten sie erst einmal eine ganze Ansammlung provisorischer Hütten und Verkaufsstände passieren, die Andenken, billigen Schmuck und sonstigen Ramsch anboten. Auf einem Tisch sah Anita sogar eine Schneekugel mit dem Eiffelturm stehen. Als sie sich grinsend abwandte, wurde sie von einer älteren Frau angerempelt.
»Du hättest nicht herkommen sollen«, raunte sie Anita zu. »Schon gar nicht mit der Sonnenscheibe. Hüte dich, er ist hier.«
Verblüfft drehte Anita sich zu der Frau um, die weitergegangen war. In den Touristenströmen zwischen den Verkaufsständen konnte sie sie jedoch nicht mehr entdecken. Hatte sie sich diese Begegnung nur eingebildet?
Reflexartig fasste sie sich ans Amulett. Es war noch immer unter ihrer Bluse verborgen. Als sie versuchte, die Worte der Frau leise zu wiederholen, erlebte sie die nächste Überraschung. Die Frau hatte in einer Sprache gesprochen, die sie noch nie gehört hatte. Trotzdem hatte Anita jedes Wort verstanden und konnte es auch wiederholen. Sie spürte das heftige Schlagen ihres Herzens. War sie etwa noch immer in einem Albtraum gefangen? Alles andere um sie herum war jedoch normal.
Mit größter Willensanstrengung riss sie sich von diesen Gedanken los und folgte der Menschenmenge zu den Ruinen. Bisher hatte sie nur wenige Bilder der großen Pyramiden gesehen. Als sie endlich in ihrem Blickfeld auftauchten, bekam sie plötzlich einen Schock, als hätte ihr jemand Eiswasser über den Kopf geschüttet. Genau hier hatte die Handlung ihres Traums stattgefunden!
Wie in Trance lief sie die Strecke ab, die sie auch im Traum zurückgelegt hatte. Natürlich gab es viele der Gebäude aus ihrem Traum nicht mehr. Oder es war nur noch der Grundriss der Mauern erkennbar. Aber es bestand für sie nicht die Spur eines Zweifels, dass die Handlung genau hier stattgefunden hatte. Vielleicht sollte sie sich doch einmal mit den Esoterikern aus ihrem Reisebus unterhalten. Womöglich hatten die eine einigermaßen sinnvolle Erklärung dafür, was ihr gerade widerfuhr. Unwirsch schüttelte sie den Kopf. Nein, die ganz bestimmt nicht.
Benommen lief sie einer Gruppe von Touristen nach, die die sogenannte Sonnenpyramide aus der Nähe anschauen wollten. Ihr kam der Gedanke, dass es Quatsch war, dieses Bauwerk Sonnenpyramide zu nennen, auch wenn ihr kein vernünftiger Grund dafür einfiel. Für sie hatte dieses uralte Bauwerk eine dunkle, bedrohliche Ausstrahlung. Je näher sie der Pyramide kam, desto stärker verkrampfte sie sich. Schließlich blieb sie unschlüssig stehen.
Ein stechender Schmerz im Bein riss sie aus ihren Gedanken und ließ sie stürzen.
»Haben Sie sich wehgetan? Tut mir leid, aber Sie sind so plötzlich stehen geblieben ...«
Verwirrt schaute Anita den Mann an, der sie auf Englisch mit spanischem Akzent angesprochen hatte.
Er war groß und kräftig, ein Berg von einem Mann. In seiner linken Hand hielt er einen schweren Metallkoffer. Zumindest nahm Anita an, dass er schwer sein musste, denn er war die Ursache ihres Schmerzes. Sie versuchte aufzustehen, gab dies jedoch gleich wieder mit einem Stöhnen auf. Sie konnte das Bein nicht belasten.
»Haben Sie sich etwas getan?«
Bevor sie etwas entgegnen konnte, griff der Hüne nach ihrem verletzten Bein. Sie ärgerte sich darüber und über seine Fragen, ob sie sich etwas getan habe. Schließlich hatte er ihr etwas getan, nämlich ihr seinen Koffer ans Bein gerammt.
»Au!«, entfuhr es ihr, als er das Bein abtastete. »Wollen Sie es mir auch noch brechen?«
Es ärgerte sie, dass er bestimmte, was geschah, während sie nur hilflos auf dem Boden saß.
»Nun stellen Sie sich nicht so an. Es ist nur geprellt. Mehr als einen blauen Fleck gibt das nicht. Am besten kommen Sie mit zum Lager. Da haben wir eine Salbe gegen Prellungen und etwas Eis zum Kühlen.«
Wieder fühlte sie sich bevormundet. Er behandelte sie wie eine unreife Göre. Allerdings war der Vorschlag vernünftig. Sie konnte schließlich nicht einfach auf dem Boden sitzen bleiben.
»Von welchem Lager reden Sie überhaupt? Und wie soll ich da hinkommen?«
Anita wollte zumindest wieder etwas die Kontrolle zurückbekommen und ihn außerdem ihre Verärgerung spüren lassen. Ihren aggressiven Ton schien er jedoch gar nicht zu bemerken.
»Auf der Rückseite der großen Pyramide ist ein archäologisches Forschungsteam mit der Untersuchung der Höhlen beschäftigt, die es dort gibt. Kommen Sie, ich helfe Ihnen auf und stütze Sie. Dann wird es schon gehen.«
Sie stellte sich absichtlich etwas ungeschickter an und hängte sich mit mehr Gewicht an seine Schulter, als es wegen des schmerzenden Beins nötig gewesen wäre. Er schien allerdings gar nichts von ihrem Gewicht zu spüren.
Ein Mann unbestimmbaren Alters mit John-Lennon-Brille kam auf sie zu.
»Hey, Juan, da bist du ja endlich. Wen hast du denn da im Schlepptau?«
»Die Touristin hat sich ihr Bein an dem Koffer gestoßen und braucht jetzt etwas Salbe und einen Eisbeutel. Können Sie sich darum kümmern, Professor?«
Während Anita wütend darüber wurde, dass dieser Koloss ihr erneut die Schuld an dem Unfall gab, lachte der Professor kurz auf.
»Läufst du wieder alles platt, was sich dir in den Weg stellt? Bring’ sie hier ins Zelt. Ich mache dann den Rest.«
Nachdem er Anita auf einer Pritsche abgesetzt hatte, verließ Juan das Zelt wieder. Der Professor holte einen Erste-Hilfe-Kasten aus einer Truhe und kam auf Anita zu.
»Vielleicht sollte ich mich erst einmal vorstellen: Mein Name ist Raoul Montoya, und ich leite diese kleine Expedition. Und wer sind Sie?«
»Anita Velasquez. Ich bin, wie ihr Mitarbeiter schon richtig vermutete, als Touristin hier.«
Er antwortete etwas auf Spanisch, was Anita nicht verstand.
»Tut mir leid«, antwortete sie auf Englisch, »aber ich spreche nur ein paar Worte Spanisch. Meine Großeltern stammen zwar aus Mexiko, aber ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen.«
»Da muss ich mich wohl entschuldigen. Bei Ihrem Namen hatte ich einfach vorausgesetzt, dass Sie Spanisch sprechen.«
Zu ihrer Überraschung hatte er die letzten beiden Sätze in akzentfreiem Deutsch gesprochen.
»Ich komme viel herum«, beantwortete er ihre unausgesprochene Frage, »und spreche einige Sprachen. Lassen Sie mich jetzt mal Ihr Bein ansehen. Ich bin zwar kein Arzt, habe aber eine Sanitäterausbildung. Archäologische Expeditionen sind nicht immer so nahe an der Zivilisation, wie hier in Teotihuacán.«
Anita schob vorsichtig ihr Hosenbein nach oben. Der Unterschenkel, an dem sie der Koffer getroffen hatte, schillerte bereits in gelbgrünen Farben.
»Na das wird ja höchste Zeit«, murmelte Professor Montoya, »wenn nicht der ganze Unterschenkel anschwellen soll.«
Er verteilte großzügig eine kühlende Salbe auf der Prellung.
»Ich hole Ihnen noch einen Eisbeutel«, sagte er und verließ das Zelt.
Anita schaute auf die Uhr. Sie hatte noch vier Stunden Zeit, bevor ihr Bus wieder nach Mexiko-City zurückfuhr. Die Schmerzen ließen bereits nach. In einer Stunde sollte sie in der Lage sein, die Ruinen noch weiter zu besichtigen, bevor sie zum Parkplatz zurückschlenderte. Solange würde sie sich hier ausruhen. Sie fühlte sich erschöpft. Ob das an dem schmerzenden Bein lag? Oder machte die Salbe sie etwa schläfrig? Wann kam endlich dieser Professor Montoya mit dem Eisbeutel?
Während sie an den Professor dachte, lief es ihr kalt den Rücken herunter. Er war nett und hilfsbereit gewesen, aber irgendetwas an ihm irritierte sie, auch wenn sie nicht genau bestimmen konnte, was es war. Wahrscheinlich war sie einfach erschöpft und sah Gespenster. Das war ja auch kein Wunder, wenn sie sich an ihre Albträume der letzten Nacht erinnerte. Nicht nur, dass sie deshalb schlecht geschlafen hatte. Die Träume und diese Ruinen ergaben eine gespenstische Mischung. Die alte Frau fiel ihr wieder ein. Was hatte sie noch gesagt?
»Du hättest nicht herkommen sollen«, zitierte sie die alte Frau leise und benutzte dabei unbewusst die fremde und doch vertraute Sprache.
»Was sagten Sie gerade?«
Anita zuckte zusammen. Professor Montoya stand am Zelteingang und beobachtete sie, wie eine Mikrobe unter dem Mikroskop.
»Haben Sie mich aber erschreckt. Ich habe Sie gar nicht kommen hören.«
»Hier ist Ihr Eisbeutel.«
In der Hand hatte er einen Plastikbeutel, der mit leicht angetauten Eiswürfeln gefüllt war. Bevor sie etwas sagen konnte, legte er ihr den Beutel auf die Prellung.
»Sie sagten gerade etwas in einer seltsamen Sprache. Das weckt natürlich sofort meine wissenschaftliche Neugier. Was war das denn?«
»Keine Ahnung. Eine Frau sagte das zu mir, als ich durch die Andenkenbuden schlenderte. Ich weiß auch nicht, was diese Worte bedeuten«, log sie. »Kennen Sie diese Sprache?«
»Nein, ich habe sie noch nie gehört.«
Anita war sicher, dass seine Antwort genauso wenig der Wahrheit entsprach wie ihre. Es wäre wohl besser, wenn sie dieses Lager verließ, sobald ihr Bein das ermöglichte.
»Ruhen Sie sich einfach etwas aus. Ich schaue nachher noch einmal nach Ihnen.«
»Ja, danke, das mache ich.«
Sie wartete, bis er das Zelt verlassen hatte. Dann versuchte sie, ihr Bein zu belasten. Es mochte undankbar sein, aber sie wollte sich wieder unter die Touristen mischen, bevor er zurückkam. Ein heftiger Schmerz im Bein ließ sie ihr Vorhaben noch etwas verschieben.
Sie schaute auf die Uhr. In einer Viertelstunde spätestens würde sie es wieder versuchen. Notfalls musste sie die Strecke zum Bus unter Schmerzen zurücklegen. Für einen Moment legte sie ihren Oberkörper auf die Liege.
Dann war sie eingeschlafen.
(Ende der Leseprobe)